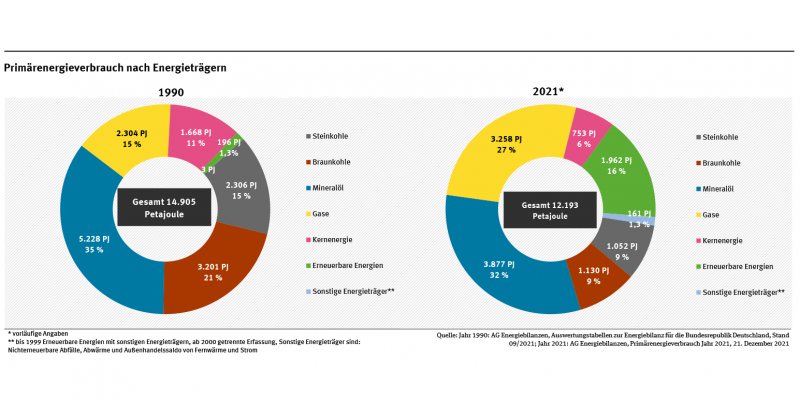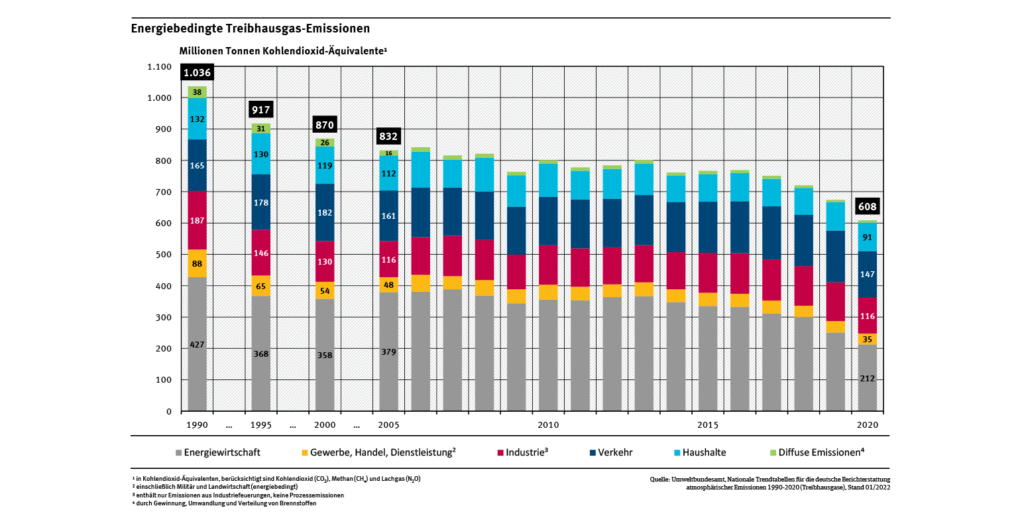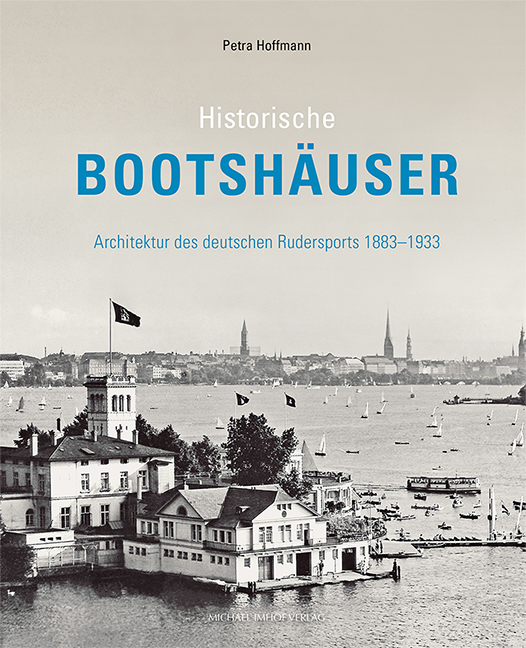Wie können wir noch schneller aus der Kohleverstromung aussteigen und gleichzeitig eine wettbewerbsfähige und klimafreundliche Energieversorgung im Industrieland Nordrhein-Westfalen sichern? Antworten gibt die Fortschreibung der Energieversorgungsstrategie, die ich am 16. Dezember 2021 dem Landtag vorgestellt habe. Damit setzt sich die Landesregierung noch ambitioniertere Ziele beim Ausbau der Erneuerbaren und untermauert diese mit konkreten Maßnahmen und Initiativen.
Seit Veröffentlichung der Energieversorgungsstrategie NRW vor zwei Jahren haben wir in Nordrhein-Westfalen schon viel erreicht und umgesetzt: Wir gehen beim Kohleausstieg voran, haben den Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft eingeleitet und belegen beim Ausbau der erneuerbaren Energien im Ländervergleich vordere Plätze. Um die auf Bundes- und Landesebene angehobenen Klimaschutzziele zu erreichen, beschleunigen wir nun mit konkreten Maßnahmen den Ausbau von Windkraft und Photovoltaik und treiben den Umbau zum klimaneutralen Energiesystem der Zukunft voran.
Vor diesem Hintergrund fasst die Landesregierung nun ihre Zielsetzungen für den Ausbau der erneuerbaren Energien deutlich ambitionierter:
Bei der Photovoltaik wollen wir eine Verdreifachung, möglichst Vervierfachung der Leistung von rund 6 Gigawatt (GW) im Jahr 2020 auf 18 bis 24 GW im Jahr 2030 erreichen. Die Leistung bei der Windenergie soll von 6 GW im Jahr 2020 auf 12 GW in 2030 verdoppelt werden. Sofern es die energiewirtschaftlichen Voraussetzungen erlauben, werden wir den Anteil der Erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung auf mehr als 55 Prozent bis 2030 steigern
Diese höchst ambitionierten Zielsetzungen sind mit einem umfassenden Maßnahmen- und Forderungskatalog unterlegt. Beispielsweise wird die Landesregierung den Landesentwicklungsplan ändern, die Rahmenbedingungen für die Freiflächen-Photovoltaik verbessern sowie bisher ungenutzte Flächenpotenziale für die Windenergie erschließen.
Darüber hinaus enthält die Fortschreibung konkrete Maßnahmen und Forderungen an den Bund im Hinblick auf die Gewährleistung der Versorgungssicherheit, die Beschleunigung des Netzausbaus, Entlastungen beim Strompreis, die Sicherstellung der Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft, den Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft und eine erfolgreiche Wärmewende in Nordrhein-Westfalen.
Um den notwendigen Zubau erheblicher Kapazitäten flexibler Gaskraftwerke zu ermöglichen, fordert die Landesregierung effiziente Förder- und Marktmechanismen. Ferner prüfen wir unter Einbeziehung der Kommunen auch die Einführung einer kommunalen Wärmeplanung für Nordrhein-Westfalen und unterstützten die Abschaffung der EEG-Umlage.
Der Bund hat einen Koalitionsvertrag – wir haben eine Gesamtstrategie. Die neue Bundesregierung hat sich im Koalitionsvertrag ambitionierte Ziele für die Energiewende in Deutschland gesetzt. Größtenteils müssen diese jedoch noch mit Maßnahmen und Umsetzungsansätzen unterlegt werden. Nordrhein-Westfalen ist hier weiter: Denn mit der Fortschreibung der Energieversorgungsstrategie und den darin enthaltenen konkreten Maßnahmen und Forderungen bleiben wir als mit Abstand wichtigstes Energieland Taktgeber der Energiewende. Wir zeigen einen Weg auf, wie die beschleunigte Transformation des Energiesystems Richtung Klimaneutralität gelingen kann, ohne die Versorgungssicherheit und die Bezahlbarkeit der Energieversorgung zu gefährden.
In Fachworkshops hat das Energieministerium zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter aus Energiewirtschaft, Gewerkschaften, Industrie, Wissenschaft und Verbänden an der Fortschreibung der Energieversorgungsstrategie NRW beteiligt.
Das Dokument finden Sie hier: https://www.wirtschaft.nrw/pressemitteilung/fortschreibung-energieversorgungsstrategie2021
Fortschreibung 2021 der Energieversorgungsstrategie NRW
Auszug aus der Zusammenfassung:
Umsetzungsstand der Energieversorgungsstrategie NRW
Ergänzend zu dem Blick auf die geänderten Rahmenbedingungen, kommt eine Fortschreibung nicht
umhin, auch Bilanz zu ziehen und auf das zu schauen, was bereits erreicht und umgesetzt werden
konnte. Denn seit Veröffentlichung der Energieversorgungsstrategie NRW hat die Landesregierung
zielgerichtet an deren Umsetzung gearbeitet. Anhand von zehn exemplarischen Meilensteinen wird
deutlich, mit welch großem Engagement Nordrhein-Westfalen die Energiewende mitgestaltet und vo-
ranbringt.
NRW ist Frontrunner beim Kohleausstieg
Basierend auf den bundesgesetzlichen Vorgaben hat Nordrhein-Westfalen die Umsetzung des Koh-
leausstiegs eingeläutet. Während in den ostdeutschen Braunkohleländern die ersten endgültigen Still-
legungen von Braunkohlekraftwerken erst im Jahr 2028 erfolgen, wurde der erste Block im Rheini-
schen Revier bereits Ende 2020 stillgelegt. Bis einschließlich 2029 übernimmt Nordrhein-Westfalen
insgesamt mehr als 70 Prozent der bundesweit zu reduzierenden Braunkohlekapazitäten und ist da-
mit Vorreiter beim Kohleausstieg. Auch im Hinblick auf die Reduzierung der Steinkohleverstromung
geht Nordrhein-Westfalen mit gutem Beispiel voran. Knapp 50 Prozent der in den ersten drei Stein-
kohle-Ausschreibungen bezuschlagten Leistung von 8,4 Gigawatt (GW) entfallen auf Anlagen in
Nordrhein-Westfalen. Mit dem Kohleausstieg übernimmt Nordrhein-Westfalen daher schon jetzt eine
besondere Verantwortung für den Klimaschutz und trägt wesentlich zu einer deutlichen Emissions-
minderung im Energiesektor bei.
NRW belegt Spitzenplätze beim Ausbau der erneuerbaren Energien
Beim Ausbau der erneuerbaren Energien belegt Nordrhein-Westfalen im deutschlandweiten Vergleich
Spitzenplätze. Trotz nicht optimaler Standortvoraussetzungen und sehr dichter Besiedlung nahm
Nordrhein-Westfalen beim Ausbau der Windenergie an Land mit einem Nettozubau von rund 280 Me-
gawatt (MW) im Jahr 2020 Platz 1 ein (Bruttozubau: 314 MW). Damit lag die installierte Leistung von
Windenergieanlagen in Nordrhein-Westfalen Ende 2020 bei rund 6 GW. Im ersten Halbjahr 2021 liegt
Nordrhein-Westfalen nach Zahlen der Fachagentur Windenergie an Land e.V. mit einem Nettozubau
von 143 MW weiter in der Spitzengruppe, auf dem 3. Platz hinter den windstarken Ländern Nieder-
sachsen (199 MW) und Brandenburg (159 MW).
Bei der Photovoltaik (PV) lag Nordrhein-Westfalen im Jahr 2020 mit einem Zubau von circa 580 MW
im Bundesländervergleich auf Rang 3, nur knapp hinter dem sonnenreichen Baden-Württemberg. Mit
diesem Zubau übertraf Nordrhein-Westfalen zum fünften Mal in Folge den PV-Zubau des Vorjahres
deutlich. Die installierte PV-Leistung in Nordrhein-Westfalen lag Ende 2020 bereits bei knapp 6 GW.
Eine wichtige Grundlage für den Ausbau der erneuerbaren Energien wird mit der Verfügbarkeit von
Informationen über Potenziale und Flächenverfügbarkeiten geschaffen. Neben einer Erweiterung des
Solarkatasters hat die Landesregierung unter anderem eine grundlegende Überarbeitung der Potenzi-
alstudie Windenergie aus dem Jahr 2012 beim Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz
NRW (LANUV) in Auftrag gegeben. Zentrales Ziel dieser Überarbeitung ist die Abschätzung des Ge-
samtpotenzials zur Windenergienutzung in Nordrhein-Westfalen bis zum Jahr 2030 auf Basis aktuel-
ler Daten und Rahmenbedingungen. Abgeleitet aus den Ergebnissen der Studie kann das Potenzial
für die Windenergie in Nordrhein-Westfalen in 2030 zwischen rund 14 GW und 15 GW abgeschätzt
werden.
Startschuss für den Wasserstoff-Hochlauf in NRW erfolgt
Mit der Veröffentlichung der Wasserstoff Roadmap Nordrhein-Westfalen im November 2020 hat die
Landesregierung einen Fahrplan vorgelegt, wie Nordrhein-Westfalen den Hochlauf der Wasserstoff-
technologien vorantreiben wird. Auf der Grundlage eines umfassend angelegten Stakeholder-Prozes-
ses und einer wissenschaftlich-fundierten Begleitstudie zeigt die Roadmap, welche Bedeutung Was-
serstoff (und seine Derivate) für eine moderne, zukunftsfähige und gleichzeitig treibhausgasneutrale
Wirtschaft und Gesellschaft haben kann. Außerdem sieht die Wasserstoff Roadmap für Nordrhein-
Westfalen konkrete Zielmarken für die Jahre 2025 und 2030 vor. So sollen beispielsweise bis zum
Jahr 2025 Elektrolyseanlagen für die industrielle Wasserstoffproduktion von mehr als 100 MW sowie
120 km neue Wasserstoffleitungen mit Anbindung an überregionale Leitungen in Nordrhein-Westfalen
entstehen.
NRW treibt Beschleunigung des Netzausbaus voran
Entsprechend den Zielsetzungen der Energieversorgungsstrategie NRW hat sich die Landesregie-
rung bei zentralen Gesetzgebungsverfahren auf Bundesebene im Rahmen von Länderanhörungen
und über Anträge im Bundesrat für eine Beschleunigung des Netzausbaus eingesetzt. Als erfolgrei-
che Beispiele lassen sich die Rechtswegverkürzung für Offshore-Anbindungsleitungen und das neue
Genehmigungsrecht für Wasserstoffinfrastruktur anführen. Damit werden die Rahmenbedingungen
für Vorhaben in Nordrhein-Westfalen konkret verbessert. Denn mit dem fortschreitenden Ausbau der
Offshore-Windenergie müssen immer mehr auf dem Meer erzeugte Strommengen direkt nach Nord-
rhein-Westfalen transportiert werden.
Im Juni 2021 wurde zudem das von der Landesregierung in Auftrag gegebene „Gutachten zur Weiter-
entwicklung der Strom-Verteilnetze in Nordrhein-Westfalen aufgrund einer fortschreitenden Sektoren-
kopplung und neuer Verbraucher“ veröffentlicht, aus dem sich sowohl Hilfestellungen für die Verteil-
netzbetreiber in Nordrhein-Westfalen ableiten lassen, als auch Hinweise, welche Stellschrauben den
Investitionsbedarf in die Netzinfrastrukturen reduzieren und so schneller mehr Elektromobilität ermög-
lichen können. Ferner hat die Landesregierung das Projekt Integrierte Netzplanung NRW initiiert.
Grundlagen für erfolgreiche Wärmewende in NRW geschaffen
Mit der energieeffizienten Bereitstellung von Strom und Wärme unterstützt die Kraft-Wärme-Kopplung
(KWK) insbesondere die Flexibilisierung des Energieversorgungssystems und trägt dazu bei, den In-
dustriestandort NRW zu sichern und klimafreundlicher zu gestalten. Im Auftrag des Ministeriums für
Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie hat das LANUV die Potenzialstudie zur Kraft-
Wärme-Kopplung in NRW erstellen lassen und mit dem zugehörigen LANUV-Fachbericht eine fort-
schreibungsfähige Datengrundlage über aktuell verfügbare und künftig realisierbare KWK- und (CO2-
freie) Wärme-Potenziale geschaffen. Gemeinsam mit der LANUV-Potenzialstudie zur Nutzung indust-
rieller Abwärme, die bereits im Herbst 2019 veröffentlicht wurde, zeigt die KWK-Studie Lösungsoptio-
nen auf, wie die leitungsgebundene Wärmeversorgung und die KWK-Technologie zur Erreichung der
Klimaschutzziele beitragen können.
Energieeffiziente Gebäude und urbane Energielösungen
Im Rahmen des Projektes „100 Klimaschutzsiedlungen“ fördert Nordrhein-Westfalen den Bau und die
Sanierung von 100 Klimaschutzsiedlungen, die sich durch eine Vielfalt unterschiedlicher energeti-
scher und architektonischer Konzepte im Neubau und Bestand auszeichnen. Ziel des Projektes ist es,
die wärmebedingten CO2-Emissionen in Wohnsiedlungen und somit auch die Energiekosten konse-
quent zu reduzieren. Hierfür können alle Technologien, die zur CO2-Einsparung geeignet sind, einge-
setzt werden. Bis Ende Juli 2021 konnten alle vorgesehenen 100 Siedlungen qualifiziert werden.
Mehr als die Hälfte der Siedlungen wurden bereits fertiggestellt, die anderen befinden sich im Bau o-
der in der Planung.
Mit der Vereinbarung über die Zusammenarbeit der Landesregierung und der Verbraucherzentrale
NRW e.V. in den Jahren 2021 bis 2025 sind die notwendigen Weichen gestellt, um örtliche Energie-
beratungsperspektiven für private Haushalte langfristig zu sichern. Die bei den Beratungsstellen der
Verbraucherzentrale NRW in den Kommunen vor Ort festangestellten Energieberaterinnen und Ener-
gieberater werden somit verstetigt und in die institutionelle Förderung überführt. Eine wichtige Funk-
tion in der Energieberatung nehmen zudem die Berufsgruppen der Architektur, des Ingenieurwesens
und des Handwerks sowie etwa kommunale Betriebe wahr.
Klimaverträgliche Mobilität in NRW nimmt Fahrt auf
Der Hochlauf der Elektromobilität in Nordrhein-Westfalen konnte beschleunigt werden. Seit Anfang
2021 ist jeder vierte neu zugelassene PKW in Nordrhein-Westfalen ein Elektrofahrzeug, davon sind
etwa die Hälfte rein batterieelektrisch betriebene Fahrzeuge. Nordrhein-Westfalen war das erste Bun-
desland, das ein breites Förderprogramm für private und betriebliche Ladeinfrastruktur aufgestellt hat.
Zudem wurde öffentliche Ladeinfrastruktur für kleine und mittlere Unternehmen gefördert.
Das selbst gesetzte Ziel, bis zum Jahr 2022 20.000 Ladepunkte in Nordrhein-Westfalen zu installie-
ren, konnte weit übertroffen werden. Bereits bis Ende September 2021 wurden ca. 65.000 nicht-öf-
fentlich zugängliche und ca. 10.000 öffentlich zugängliche Ladepunkte gefördert. Maßgeblich hat die
Förderung im Rahmen des Programms progres.nrw – Emissionsarme Mobilität zur Übererfüllung des
Ziels beigetragen.
Energieforschungsoffensive: Innovationen made in NRW
Durch eine starke Energieforschung entstehen die Innovationen, die Nordrhein-Westfalen für eine be-
schleunigte Transformation zu einem klimaneutralen Energiesystem benötigt. Dies war Ansatzpunkt
der Energieforschungsoffensive.NRW der Landesregierung. Innovationen und Technologien sollen
schnell marktreif entwickelt und breit eingesetzt werden können. Durch die landesseitige Förderung
von zukunftsweisenden Projekten und weiteren Aktivitäten konnte die anwendungsnahe Energiefor-
schung in Nordrhein-Westfalen weiter gestärkt werden.
Neuausrichtung des Förderprogramms progres.nrw – Klimaschutztechnik
Im August 2021 hat die Landesregierung das überarbeitete Förderprogramm progres.nrw vorgestellt.
Der bisherige Programmbaustein progres.nrw – Markteinführung heißt nun progres.nrw – Klima-
schutztechnik. Mit der Neufassung der Förderrichtlinie ist auch eine umfassende Weiterentwicklung
der Programminhalte verbunden. In Umsetzung von Maßnahmen aus der Energieversorgungsstrate-
gie NRW wird das Programm dabei stärker auf die Energie- und Klimaschutzziele des Landes ausge-
richtet. Ziel der Neufassung der Programmrichtlinie ist es, Nordrhein-Westfalen zum Vorreiter beim
Rollout neuer Technologien für die Transformation hin zu einem klimaneutralen Energiesystem zu
machen.
Mit der neuen NRW.Energy4Climate stark aufgestellt für die Zukunft
Die Landesregierung hat die operative Begleitung ihrer Energie- und Klimaschutzpolitik neu geordnet
und zukunftsfest aufgestellt. Auftrag der neuen Landesgesellschaft NRW.Energy4Climate ist die Un-
terstützung der Klimaschutz- und Energiewendeziele bei gleichzeitiger Stärkung des Industrie- und
Technologiestandorts Nordrhein-Westfalen. Unter dem Dach der Landesgesellschaft für Energie und
Klimaschutz werden bisherige Initiativen gebündelt und gestärkt.